Ein Thema, das mir aktuell wieder begegnet ist:
Viele Menschen wehren die Beschäftigung mit schweren gesellschaftlichen Themen ab.
Ich habe das gerade wieder in meinem eigenen Familienumfeld erlebt.
Ich beschäftige mich derzeit intensiv mit Gaza und dem Nahostkonflikt - und wenn ich das erwähne, kommen sofort Reaktionen wie:
„Warum tust Du Dir das an? Beschäftige Dich doch nicht damit.“
„Glaube nicht alles, was Du siehst.“
Es ist diese typische Abwehr, die ich immer wieder beobachte.
Und wenn ich genauer hinspüre, merke ich: Dahinter steckt viel mehr als ein oberflächliches Desinteresse.
Dahinter steckt Angst.
Die Angst, von all den Gefühlen überwältigt zu werden.
Dieses innere Empfinden:
„Ich kann das gar nicht an mich heranlassen.
Ich muss das grundsätzlich abwehren - sonst wird es mich überwältigen.“
Das ist eine sehr menschliche Reaktion.
Aber aus meiner Sicht ist sie nicht gesund.
Ich glaube wirklich, dass viele Menschen nie gelernt haben, mit tiefen Emotionen umzugehen.
Und genau darüber möchte ich in diesem Blogartikel schreiben:
- Warum wir unsere Berührbarkeit verlieren - oder gar nicht erst zulassen
- Was der Preis dieser inneren Verschlossenheit ist
- Und wie wir unsere Berührbarkeit zurückerobern können
Ich selbst war einmal verschlossen.
Ich habe irgendwann wieder gelernt, mich berühren zu lassen - und dabei auch einen inneren Mechanismus entwickelt, um nicht von meinen Emotionen überwältigt zu werden.
Für mich ist diese Fähigkeit nicht nur entscheidend für meine Lebensqualität, sondern auch ein Zukunftsskill:
Wir werden als Menschheit nur weiterkommen, wenn wir es wieder lernen, uns berühren zu lassen.
Wenn wir erkennen, dass wir zusammengehören.
Dass das Leid der anderen auch unser eigenes Leid ist.
Solange wir uns vor diesen Gefühlen verschließen,
solange wir unsere Menschlichkeit abwehren,
werden wir uns nie gemeinsam den Herausforderungen auf der Welt stellen können.
Und das müssen wir.
Ein Beitrag aus meiner Reihe: Wir müssen reden.
(Gesellschaftliche Tiefenthemen, heilsam gedacht.)
Warum wir unsere Berührbarkeit verlieren
Es gibt viele Gründe, warum wir als Menschen die Tendenz haben, schwere Themen abzuwehren - warum wir unsere Berührbarkeit abwehren.
Diese Gründe greifen ineinander und verstärken sich oft gegenseitig.
Kindheitstraumatisierungen
Viele von uns haben als Kinder nicht gelernt, mit starken Gefühlen sicher zu sein.
Vielleicht waren wir traurig, wütend oder voller überschäumender Freude - aber niemand war da, der diese Gefühle halten konnte.
Niemand, der sie gespiegelt oder uns darin begleitet hat.
Im schlimmsten Fall wurden wir dafür gemaßregelt und abgelehnt.
Etwas, was für Kinder immer mit Todesangst verbunden ist.
Da sie nicht allein für sich sorgen können.
Wir wurden mit unseren Gefühlen allein gelassen, mussten uns selbst regulieren, was Kinder schlicht nicht können.
Das überfordert.
Und diese Erfahrung prägt sich tief ein.
Wenn wir als Erwachsene heute mit Situationen konfrontiert werden, die unsere tiefen Emotionen anrühren könnten, springt dieses alte Muster sofort an:
„Das darf ich nicht fühlen.
Ich kann das nicht halten.
Es wird mich überwältigen.“
oder
"Gefühle zuzulassen und auszudrücken
ist gefährlich für mich."
Also machen wir dicht.

Manchmal verschließen wir unser Herz, um uns zu schützen.
Gesellschaftliche Konditionierung - Härte statt Gefühl
Hinzu kommt unsere kollektive Erziehung - gerade in der deutschen Geschichte. Geprägt vom Preußentum, vom 3. Reich und dem Soldatentum:
„Nur die Harten kommen in den Garten.“
Emotionen gelten als störend, sie lenken vom Funktionieren ab.
Wir lernen schon früh, dass Emotionalität - ob unsere eigene oder die der anderen – als Schwäche ausgelegt wird.
Das Leid anderer soll uns nicht berühren, weil wir uns das eigene Leid nicht eingestehen dürfen.
Viele von uns wurden wie kleine Soldaten großgezogen:
stark sein, aushalten, weitermachen.
Zärtlichkeit, Intimität oder echte Berührung hatten kaum Raum.
Nicht aus Bosheit sondern aus Unwissen und aufgrund eigener unverarbeiteterTraumata.
Dies gilt umsomehr, wenn es um das Aufwachsen von Männern geht, denen noch weniger Gefühle zugestanden wurden und immer noch werden.
Intergenerationale familiäre Traumata - Das Erbe des 'Funktionieren müssens'
Die gefühlsmäßigen Abwehrmechanismen sind in unseren Familiengeschichten oft seit Generationen verankert.
Gerade in Deutschland gibt es familiäre Traumatisierungen: Krieg, Flucht, Vertreibung, Ausgrenzung - und natürlich das Dritte Reich.
Dieses Leid zieht sich ausgehend von den Familien durch das Kollektiv und doch entsteht paradoxerweise gerade daraus der stärkste Abwehrmechanismus.
Denn wer selbst tiefes Leid in sich trägt, aber nie lernen durfte, es zu fühlen,
der verschließt sich umso mehr vor dem Leid der anderen.
So entstehen Familien, in denen Gefühle keinen Platz haben:
nicht bestraft vielleicht, aber gedeckelt und als nicht relevant abgetan.
Wo es nur ums Überleben und Funktionieren geht,
da fehlt Berührung, emotionale Nähe - und damit Berührbarkeit.
Die innere Haltung wird:
„Ich darf mich nicht berühren lassen.
Wenn ich es zulasse, bin ich schwach.
Und falls ich es zulasse, werde ich damit nicht zurechtkommen.“
So entsteht diese Kälte, die als Schutz dient -
aber uns von unserer Lebendigkeit trennt.
„Ich kann ja eh nichts tun“
Ein Satz, der oft fällt - oder verinnerlicht ist, wenn es um schwere gesellschaftliche Themen geht, lautet:
„Ich kann ja eh nichts tun.“
Oft fällt er, wenn wir mit dem Leid anderer Menschen konfrontiert werden.
Er wirkt auf den ersten Blick rational - als würde er nur nüchtern beschreiben, dass wir das große Ganze nicht ändern können.
Doch dahinter steckt meist etwas Tieferes: ein Gefühl von Ohnmacht, das uns schon aus der Kindheit vertraut ist.
Die Ohnmacht aus der Kindheit
Als Kinder haben viele von uns Situationen erlebt, in denen wir uns klein und ausgeliefert fühlten.
Wir konnten nichts tun – nicht helfen, nicht schützen, nicht heilen.
Diese kindliche Ohnmacht prägt sich tief ein.
Wenn wir heute auf das Leid in der Welt schauen, ruft es unbewusst genau dieses Gefühl wieder wach.
Und dann reagieren wir, wie wir es gelernt haben:
mit Abwehr, innerer Starre oder einem Rückzug ins „Ich will das gar nicht fühlen“.
Gleichzeitig kommt ein zweiter Gedanke dazu:
„Ich bin doch nur ein kleines Menschlein – was soll ich schon bewirken, angesichts dieses riesigen, komplexen Leids?“
Diese Selbstwahrnehmung lässt uns noch mehr zurückweichen,
weil wir Handlungsfähigkeit mit großen, heldenhaften Gesten verwechseln.
Von der Ohnmacht zur Handlungsfähigkeit
Doch die Wahrheit ist:
Es geht oft gar nicht um die großen Taten.
Es geht darum, die kindliche Starre hinter uns zu lassen und zu erkennen:
- Ich bin heute erwachsen.
- Ich kann Gefühle halten, ohne daran zu zerbrechen.
- Ich kann etwas tun: hinschauen, mitfühlen, bezeugen, wirken, handeln im Kleinen.
Berührbar zu sein bedeutet nicht, dass wir sofort Aktivist:innen werden müssen oder die ganze Welt retten sollen.
Es bedeutet, dass wir uns unseren Mut zurückholen und das Bewusstsein, dass wir als Mensch eine Wirkung haben.
Manchmal beginnt diese Wirksamkeit ganz leise:
indem wir hinschauen, Zeugnis ablegen, Mitgefühl zulassen und benennen, was wir sehen.
Genau hier beginnt das Zurückerobern unserer Berührbarkeit -
und mit ihr die Erfahrung, dass Ohnmacht sich in bewusste, lebendige Handlungsfähigkeit verwandeln kann.
Der Preis der Unberührbarkeit
Auf den ersten Blick wirkt es einfacher, wenn wir uns das Leid anderer Menschen vom Leib halten:
Wir schützen uns, machen uns unverwundbar, konzentrieren uns auf unser eigenes Leben - und glauben, dass wir so leichter durchs Leben kommen.
Doch diese vermeintliche Sicherheit hat ihren Preis.
Abwehr ist ein Kraftakt.
Ständig das Leid anderer abzuwehren, ob in den Nachrichten, in sozialen Medien oder im persönlichen Umfeld, kostet unglaublich viel Energie.
Denn Du musst Dir beständig bewahren: „Ich darf das nicht fühlen.“
Abwehr macht uns kalt.
Du schneidest Dich selbst von einem Teil seines Gefühlspektrums ab.
Mit der Zeit macht das hart, zynisch oder abgestumpft.
Es beraubt Dich der Tiefe:
- tief zu fühlen
- tief zu lieben
- tief lebendig zu sein.
Abwehr sperrt uns ein.
Um unberührbar zu bleiben, errichten wir Mauern.
Doch diese Mauern sind ein Kerker - oder wie ein selbstgewählter Sarg.
Wir sperren nicht das Leid aus, sondern uns selbst ein.

Unberührbarkeit schützt - aber sie sperrt uns auch in uns selbst ein.
Früher war es vielleicht leichter, sich in ein kleines, abgekapseltes Leben zurückzuziehen.
Heute sind wir global vernetzt, und die Welt berührt uns, ob wir es wollen oder nicht.
Alles hängt miteinander zusammen - auch mit unserer eigenen Geschichte.
Wenn wir uns unberührbar halten, schneiden wir uns letztlich von unserer eigenen Menschlichkeit ab.
Wir bleiben in uns selbst gefangen und verlieren die Fähigkeit, uns als Teil dieser Welt zu erfahren.
 Philosophischer Impuls: Keine menschliche Nähe ohne Verletzbarkeit
Philosophischer Impuls: Keine menschliche Nähe ohne Verletzbarkeit
Die Philosophin Barbara Schmitz spricht in ihrem Buch „Offenheit und Berührbarkeit“ über die Bedeutung von Verletzbarkeit und menschlicher Nähe.
Sie erinnert daran, dass Verletzbarkeit keine Schwäche, sondern eine Grundbedingung des Menschseins ist - und dass wir sie mit allem Lebendigen teilen.
Statt sie zu vermeiden oder zu instrumentalisieren, sollten wir Verletzbarkeit als Band zwischen Menschen verstehen - als Quelle für Resonanz, Vertrauen, Solidarität und geteilte Sinnhaftigkeit.
Wahre Stärke entsteht nicht durch Unverwundbarkeit oder reine Resilienz, sondern durch die Fähigkeit, sich berühren zu lassen - und andere in ihrer Verletzbarkeit anzuerkennen.
Vielleicht fragst Du Dich jetzt: Ist Berührbarkeit dasselbe wie Verletzbarkeit - oder wie Verletzlichkeit?
Die drei Begriffe klingen ähnlich, meinen aber nicht genau dasselbe:
- Berührbarkeit ist die Offenheit, sich von Menschen, Momenten oder der Welt anrühren zu lassen - im Herzen bewegt zu werden.
- Verletzbarkeit ist die Tatsache, dass diese Offenheit immer auch bedeutet, verletzt werden zu können. Sie ist eine Grundbedingung des Lebendigseins.
- Verletzlichkeit beschreibt das persönliche Erleben dieser Offenheit - wie sensibel, exponiert oder empfindsam wir uns in einem Moment fühlen.
Man könnte sagen:
Berührbarkeit ist der Raum.
Verletzbarkeit ist die Bedingung.
Verletzlichkeit ist die Erfahrung darin.

(Podcast-Folge auch als Audio Download verfügbar)
Wie wir unsere Berührbarkeit zurückerobern
Meine eigene Geschichte ist ein gutes Beispiel dafür, dass Berührbarkeit kein Selbstläufer ist.
Mein Weg zurück zur Berührbarkeit
Ich war schon als Kind sehr sensibel. Ich habe stark gefühlt - Freude und Schmerz, Trauer und Mitgefühl.
Doch immer wieder bin ich auf Ablehnung gestoßen:
- Bei „E.T.“ liefen mir die Tränen - und ich wurde von Schulkameraden ausgelacht.
- Selbst in Auschwitz und Auschwitz Birkenau, als wir mit einem ehemaligen Häftling durch das Lager gingen und mich die Erfahrung zutiefst bewegte, stieß ich eher auf Unverständnis als auf Mitgefühl.
Irgendwann zog ich mich innerlich zurück.
Ich baute Mauern, wurde nach außen hart - oder spielte zumindest Härte, weil ich spürte:
„In dieser Welt kann ich nicht existieren, wenn ich so weich bleibe.“
Doch innerlich hat mich diese Pose ausgehöhlt.
Ich habe gemerkt, wie sehr ich mich selbst von meinem eigenen Leben abgeschnitten habe.
Berührbarkeit zu verlieren, heißt immer auch, Lebendigkeit zu verlieren.
Erst als ich wieder angefangen habe, diese Mauern abzutragen, konnte ich meine Sensibilität als Stärke annehmen.
Ich habe gelernt, dass Gefühle kommen und gehen - und dass ich sie halten kann, ohne in ihnen zu versinken.
Und dass ich nie wieder irgendwem erlaube, mir meine Sensibilität abzusprechen.
Ich habe inzwischen verstanden, dass ich andere in ihrem Nicht-Wahrhaben-Wollen ihrer eigenen Berührbarkeit triggere, wenn ich Gefühle zeige. Weil sie selbst eine Schwäche darin sehe oder Angst haben überwältigt zu werden - und das abwehren müssen.
Berührbarkeit ist ein Reichtum. Und den lasse ich mir von niemandem nehmen.
Praktische Wege zurück zur Berührbarkeit
Hier einige Impulse, wie Du "Berührung" zulassen kannst, ohne Angst haben zu müssen, Dich im Leid der anderen und der Welt zu verlieren. Ein offenes Herz braucht auch einen gewissen Schutz. Aber das ist etwas anderes als eine Mauer drum herum zu bauen. Es ist eher wie eine durchlässige Membran, die Du regulieren darfst.

Wenn wir unser Herz wieder öffnen, kehrt Lebendigkeit zurück. Ein offenes Herz darf immer auch geschützt werden.
Gefühle dosiert zulassen
- Lass zu, was gerade da ist: Trauer, Schmerz, Mitgefühl.
- Fühle es für einen Moment, atme hinein - und erlaube ihm, wie eine Welle durch Dich hindurchzufließen.
- Du kannst Dich bewusst „verabreden“: Jetzt spüre ich hinein, danach lege ich es wieder zur Seite.
Nicht im Leid verharren
- Du musst nicht mit der Welt mitleiden, um ein mitfühlender Mensch zu sein.
- Es dient niemandem, wenn Du Dich selbst in Leid aufzehrst.
- Du darfst trotz allem das Leben genießen, einen Kaffee trinken, die Sonne spüren - ohne Schuldgefühle.
Natur und Bewegung
- Geh nach draußen: Die Natur ist der größte Trost.
- Erde Dich, schau ins Grün, beobachte den Himmel.
- Lass Gefühle in der Bewegung durch Dich hindurchfließen - beim Spazieren, Tanzen, Yoga.
Kreativer Ausdruck
- Male, schreibe, tanze oder singe Deine Gefühle.
- Kreativität verwandelt Emotionen in etwas Lebendiges.
- Für mich ist auch das Schreiben dieses Textes ein Teil meiner Verarbeitung.
Verbinde Dich mit Gleichgesinnten
- Wenn Dein Umfeld Deine Sensibilität nicht versteht, suche die Menschen, die ähnlich fühlen.
- Auch online gibt es viele, die ihre Berührbarkeit leben und teilen.
- So entstehen Resonanzräume, die Dich stärken.
Erkenne Deine eigene Wirksamkeit
- Du bist nicht mehr das ohnmächtige Kind.
- Du bist erwachsen, Du kannst fühlen, handeln, etwas bewirken - in Deinem Rahmen.
- Oft beginnt es damit, einfach hinzusehen, Zeugnis abzulegen und Deine Wahrheit auszusprechen.
Berührbar zu sein, heißt nicht, ständig überwältigt zu werden.
Es bedeutet, mit offenem Herzen in dieser Welt zu stehen, ohne daran zu zerbrechen.
Es bedeutet, lebendig zu sein - und mit Deinem Fühlen Teil der Menschheit zu sein und für Menschlichkeit zu stehen.
Abschließende Gedanken: Lass Dich berühren
Berührbarkeit ist für mich zutiefst mit unserer Menschlichkeit verbunden.
Menschlichkeit und Berührbarkeit
Wenn wir in dieser Welt je nach einem inneren Kompass suchen,
einem, der uns leitet durch all das Chaos, die Konflikte und das kollektive Leid –
dann wird es immer die Menschlichkeit sein, die uns trägt.
Und Menschlichkeit beginnt mit Berührbarkeit.
Ich glaube zutiefst, dass diese Berührbarkeit in uns allen schlummert.
Manche von uns haben sie aus guten Gründen verschlossen,
weil es zu weh tat, zu viel war oder nicht verstanden wurde.
Ich selbst habe sie lange abgetan, hinter Mauern gesperrt,
um mich zu schützen - und habe doch gespürt, wie sehr mir etwas fehlte.
Zeugnis ablegen
Aber Berührbarkeit lässt sich zurückerobern.
Sie ist nie verloren, nur manchmal verschüttet.
Wir holen sie zurück, wenn wir beginnen hinzuschauen.
Wenn wir bereit sind, Zeugnis abzulegen:
Ich sehe, was in dieser Welt geschieht.
Und ich lasse mich davon berühren.
Für mich war es der Holocaust, der mich nie losgelassen hat.
Er begleitet mich, vielleicht mein Leben lang.
Weil dort für mich die Essenz von Menschlichkeit und Unmenschlichkeit
so greifbar nebeneinanderstehen.
Weil ich immer noch versuche zu verstehen -
auch wenn mir das nie gelingen wird.
Und weil ich spüre: Es beginnt alles damit, dass wir hinsehen.
Dass wir nicht wegschauen, sondern sagen:
Ich sehe es. Ich lege Zeugnis ab.
(Der entsprechende englische Ausdruck trifft hier fast noch besser:
Beaering witness.)
 Was bedeutet „Zeugnis ablegen“?
Was bedeutet „Zeugnis ablegen“?
Zeugnis ablegen heißt: hinsehen und etwas als wahr anerkennen, was ist.
Nicht weglaufen. Nicht wegschauen.
- Es bedeutet, das Leid anderer wahrzunehmen und innerlich zu bezeugen.
- Es verlangt keine großen Taten - nur die Bereitschaft, berührbar zu bleiben.
- Auf Englisch wird das oft als „Bearing Witness“ bezeichnet.
Schon in dem Moment, in dem Du wirklich hinsiehst, es in Dir wirken lässt und es als wahr-nimmst, bist Du Teil der Menschlichkeit, die diese Welt so dringend braucht.
Einladung zur Menschlichkeit
Darum lade ich Dich ein:
Lass Dich berühren.
Schau hin.
Du musst nichts tun, Du musst nichts beweisen.
Aber in dem Moment, in dem Du Dein Herz öffnest und Zeugnis ablegst,
bist Du schon Teil der Menschlichkeit, die diese Welt so dringend braucht.
Es kann reichen, wenn Du das für andere modellierst.
Denn manchmal müssen wir voran gehen und Vorbild sein für andere.
Menschlichkeit heißt, mein Herz zu öffnen, mich berühren zu lassen und mich im anderen zu erkennen. Sie ist der wahre Kompass in dieser Welt. Wenn Du Dich je fragst, auf welche Seite Du Dich stellen sollst, stelle Dich auf die Seite der Menschlichkeit.

Menschlichkeit ist der Kompass, der uns durch diese Welt trägt.

In dieser Reihe gehe ich den tieferliegenden Fragen unserer Zeit nach:
Was passiert mit unserer Menschlichkeit?
Was brauchen wir als Gesellschaft wirklich?
Wie finden wir zurück ins Gleichgewicht?

- Gaza & Israel: Auf der Seite der Menschlichkeit – Hintergründe, Fakten, Perspektiven
- Was bedeutet Würde? Die wahre Bedeutung von „Die Würde des Menschen ist unantastbar“
- Die Krise unserer Zeit – Wenn Verstand und Herz getrennt sind


Trag Dich hier in meinen Newsletter ein und erfahre, wenn neue Texte erscheinen.
Bildquelle:
Titelbild (Hand streicht durch Gräser): Foto von Tima Ilyasov auf Unsplash
Geschlossene Rosenblüte: Hrant Khachatryan für Unsplash+
Schneckenhaus auf Blatt: Dylan Leagh für Unsplash+
Gelbe Rose: Foto von Teo Lê auf Unsplash
Hände formen Herz vor Sonne: Curated Lifestyle für Unsplash+
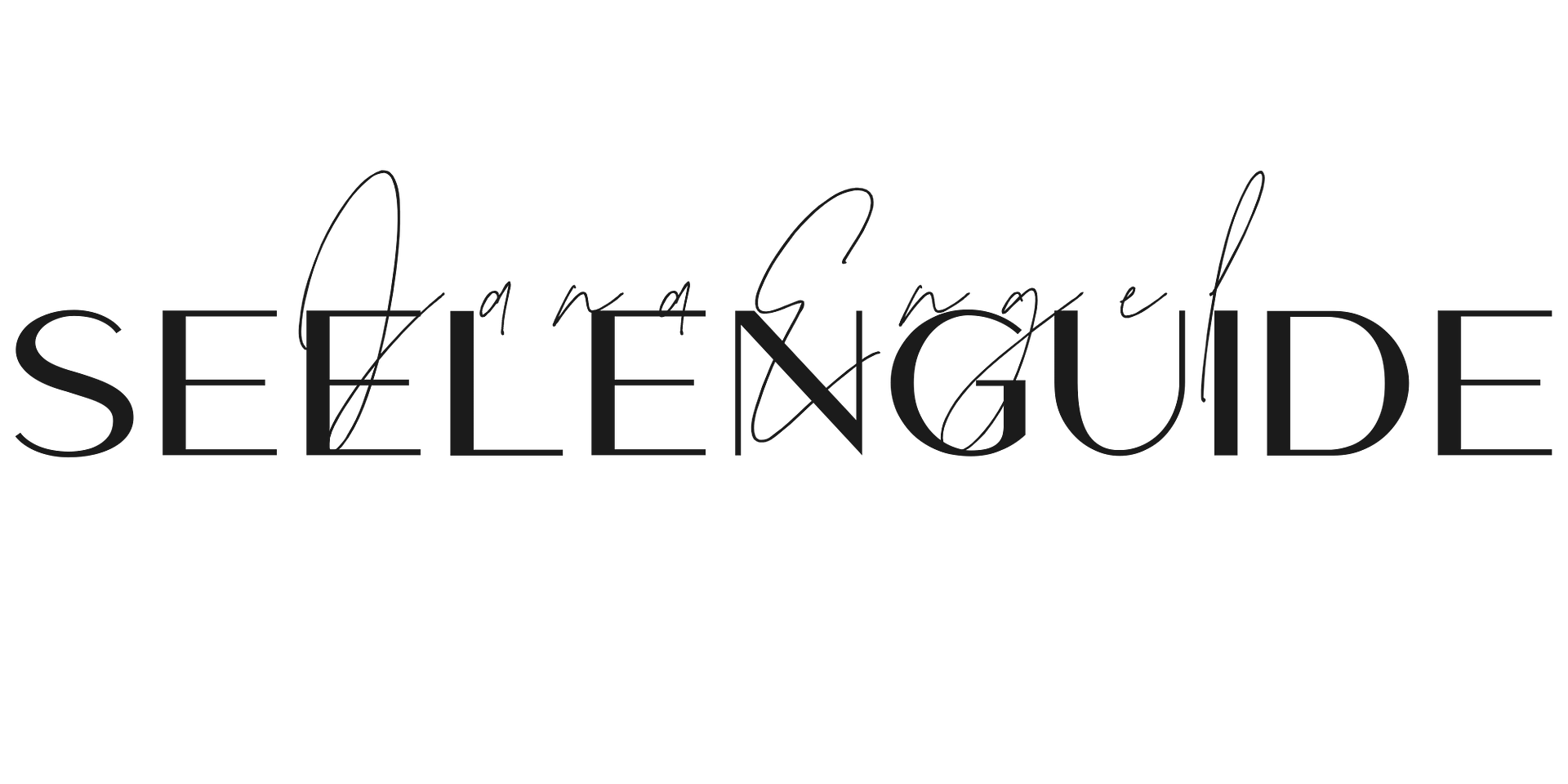
 Philosophischer Impuls: Keine menschliche Nähe ohne Verletzbarkeit
Philosophischer Impuls: Keine menschliche Nähe ohne Verletzbarkeit Was bedeutet „Zeugnis ablegen“?
Was bedeutet „Zeugnis ablegen“?