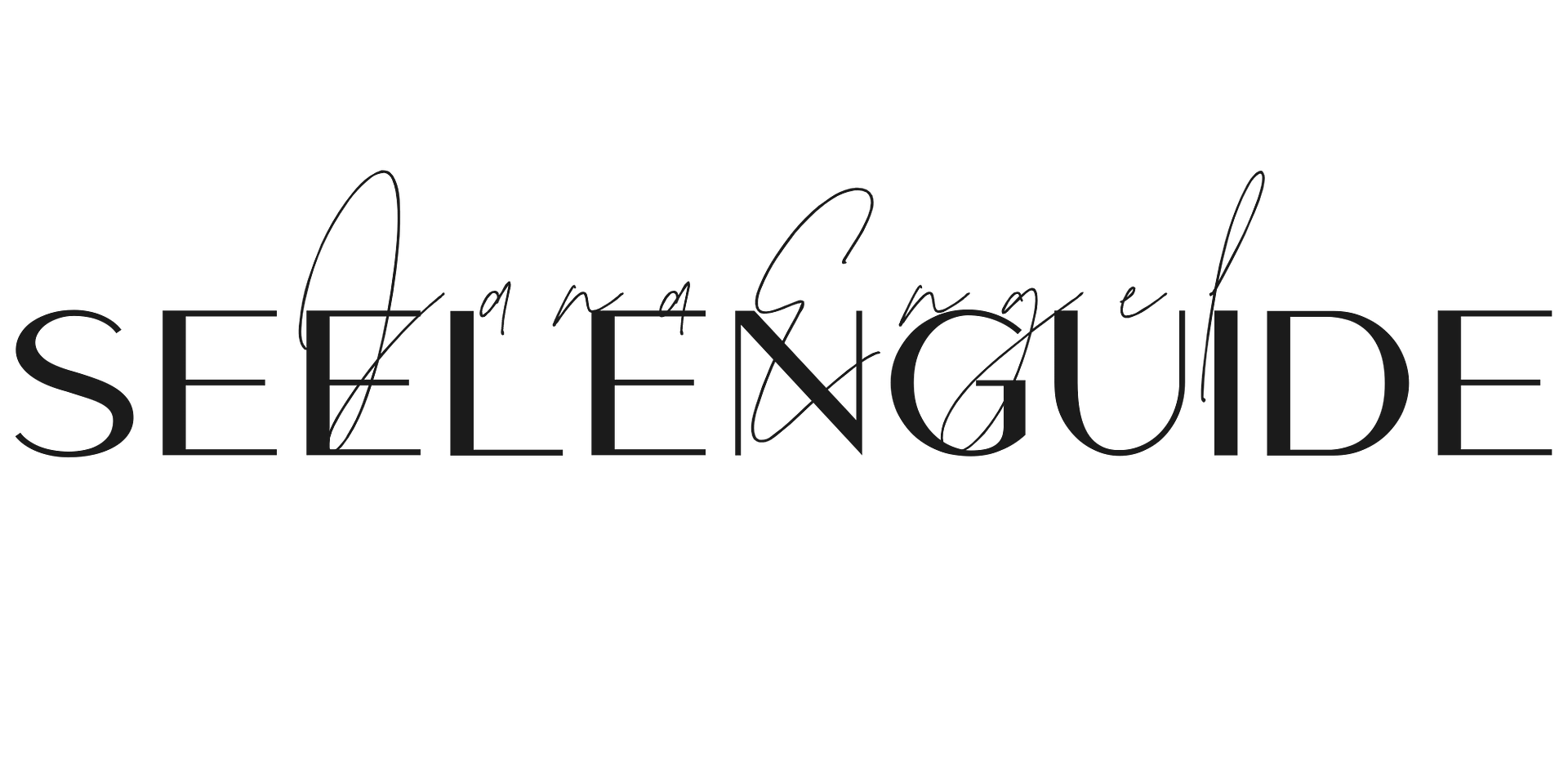Die Täter-Opfer-Dynamik zwischen Israel und Palästina zeigt, wie individuelle Traumata in kollektive Gewaltstrukturen übergehen - und warum Bewusstwerdung der erste Schritt zur Heilung ist.
Ich habe mich in meinem Dossier zu Gaza & Israel bereits mit den Hintergründen der Gewalt auseinandergesetzt.
In diesem Artikel möchte ich ein anderes Muster sichtbar machen -
die Parallelen zwischen dem Verhalten Israels gegenüber den Palästinenser:innen und den Dynamiken häuslicher Gewalt.
Ich weiß: Dieser Vergleich ist ungewöhnlich - vielleicht unbequem.
Doch genau darum schreibe ich ihn.
Weil wir das Muster erkennen müssen, um es zu durchbrechen.
Individuelle Prozesse bieten immer auch einen Zugang, um kollektive zu verstehen.
Denn oft zeigen sich dieselben Bewegungen - nur auf einer anderen Ebene.
Dieser Text ist ein Gedankenspiel.
Er will keine Lösungen präsentieren, sondern Bewusstsein schaffen.
Denn das ist immer der erste Schritt zu Veränderung.
Dieser Artikel ist Teil meines Gaza–Israel-Dossiers.
Er erweitert die Perspektive um die psychologischen Muster hinter der Gewalt.
Disclaimer
Mein Artikel enthält keine expliziten Darstellungen von häuslicher Gewalt oder physischer Gewalt.
Bitte entscheide dennoch selbst, ob Du über dieses Thema lesen möchtest.
Sorge gut für Dich.
Die Parallele zu häuslicher Gewalt
Häusliche Gewalt - ob physisch oder psychisch - ist kein einzelnes Ereignis, sondern ein System.
Ein System, das Kontrolle aufrechterhält und Autonomie zerstört.
Oft beginnt es unsichtbar: mit subtiler Kritik, mit Gaslighting, mit kleinen Grenzverschiebungen.
Es endet dort, wo ein Mensch das Gefühl verliert, über sich selbst bestimmen zu dürfen.
Was ist „Coercive Control“?
Der Begriff stammt vor allem von Evan Stark, einem Soziologen, der häusliche Gewalt neu gerahmt hat: nicht als einzelne Gewalthandlungen, sondern als System sozialer Kontrolle, das über Zeit Macht und Autonomie einer Person zerstört.
Es geht um:
- Isolierung: „Niemand versteht dich, niemand ist auf deiner Seite.“
- Gaslighting & Schuldumkehr: „Du bist selbst schuld an meiner Reaktion.“
- Überwachung & Kontrolle: „Ich weiß, was Du tust. Ich entscheide, wann Du darfst.“
- Abhängigkeit schaffen: finanziell, emotional, infrastrukturell.
- Zerstörung des Selbstvertrauens: „Du kannst gar nicht ohne mich leben.“
Kurz gesagt: ein System der Unterwerfung durch psychologische, soziale und strukturelle Gewalt, das sich hinter der Fassade vermeintlicher „Ordnung“ oder „Sicherheit“ verbirgt.
„Was im Privaten Gewalt ist, erscheint im Politischen als Sicherheitspolitik.“
Parallelen zu staatlicher Gewalt - Israel und Palästina
Wenn man dieses Konzept als strukturelle Dynamik liest, erkennt man frappierende Ähnlichkeiten.
- Isolation: Gaza wird physisch, ökonomisch und kommunikativ abgeschottet - wie ein Partner, der den anderen vom sozialen Umfeld abschneidet.
- Überwachung & Kontrolle: Israel kontrolliert Grenzen, Luftraum, Wasser, Strom, digitale Kommunikation, Warenfluss - der Täter bestimmt, was erlaubt ist.
- Gaslighting & Schuldumkehr: Das Narrativ, Palästina sei „selbst schuld“, man „verteidige sich nur“ - trotz eklatant asymmetrischer Machtverhältnisse.
- Abhängigkeit schaffen: Hilfsgelder, Arbeitsgenehmigungen, Infrastruktur - alles läuft durch israelische Strukturen; Abhängigkeit wird systemisch reproduziert.
- Zerstörung von Autonomie & Identität: Delegitimierung palästinensischer Staatlichkeit, Sprache, Kultur - das kollektive Selbstwertgefühl wird gezielt angegriffen.
- Enabler: Internationale Akteure (USA, EU, Deutschland) rationalisieren oder decken dieses Verhalten - wie Angehörige, die „nicht eingreifen, weil es kompliziert ist“.
Es ist, als würde ein Partner seine Kontrolle immer weiter ausbauen -
und das Umfeld schaut weg oder entschuldigt: „Aber sie provoziert ihn doch auch manchmal...“
Das Muster ist nicht identisch.
Aber energetisch gleich strukturiert.
Warum dieser Vergleich hilfreich ist
Weil er nicht moralisiert, sondern systemisch schaut.
Er zeigt: Es geht hier nicht um einzelne Taten, sondern um eine Kultur der Kontrolle,
in der Gewalt das Instrument ist, um Dominanz zu sichern.
Wenn man so hinschaut, entstehen neue Fragen:
- Was passiert, wenn das Opfer nicht mehr nur überlebt, sondern sich innerlich befreit?
- Welche Rolle spielen Zeugen und Enabler in der Aufrechterhaltung des Systems?
- Wie kann Heilung geschehen - ohne Retraumatisierung oder neue Abhängigkeiten?
Dynamiken - Täter - Opfer - Enabler
Bevor wir diese Dynamiken im kollektiven Kontext betrachten, lohnt sich ein Blick auf die individuelle Ebene.
In häuslicher Gewalt entfaltet sich ein Dreieck aus Täter, Opfer und Enablern - ein geschlossenes System, das sich selbst stabilisiert.
Der Täter braucht Kontrolle, um seine innere Unsicherheit zu regulieren.
Das Opfer versucht zu überleben, passt sich an, verliert Stück für Stück die eigene Autonomie.
Und die Enabler - Familie, Umfeld, Gesellschaft - schauen weg, relativieren oder rechtfertigen das Verhalten.
Diese Dreiecksstruktur hält sich, solange niemand sie unterbricht.
Erst wenn eines der Elemente sich verändert - wenn das Opfer Grenzen zieht, der Täter konfrontiert wird oder die Enabler nicht länger schweigen - kann sich das System wandeln.
Genau diese Dynamik lässt sich auch auf kollektive Zusammenhänge übertragen.
Wenn wir also über Israel, Palästina und den Westen sprechen,
können wir dieselben psychologischen Grundbewegungen beobachten -
nur auf einer anderen, weit größeren Bühne.
Die Täter-Dynamik: Israel
Wenn man Israel nicht nur als Staat, sondern als Traumakörper betrachtet,
zeigt sich ein paradoxes Muster:
„Der Traumatisierte wird zum Täter, wenn er das Trauma nicht integriert, sondern externalisiert.“
Israel ist eine Gesellschaft, geboren aus kollektiver Verfolgung -
aus der tiefen, unverarbeiteten Erfahrung von Ohnmacht, Vertreibung, Vernichtung.
Das „Nie wieder Opfer sein“ wurde - unbewusst - zu
„Nie wieder schwach sein. Nie wieder kontrolliert werden.“
Kontrolle als Identität
So entstand ein Kontrollsystem als Identitätsersatz.
Das Bedürfnis, Kontrolle über Andere zu haben, sie zu disziplinieren, zu definieren, ihrer habhaft zu werden.
Ein Versuch, Sicherheit zu erzwingen, wo Vertrauen fehlt.
Man bekämpft im Außen das, was im Inneren nicht gefestigt ist.
Die eigene Zersplitterung wird im Anderen reproduziert.
Der Riss als Spiegel des eigenen Risses
„Israel hat einen Riss durch die palästinensische Identität gezogen,
weil es selbst zerrissen ist.“
Die Fragmentierung, die Palästina zugefügt wurde -
Zerreißung von Land, Familien, Zugehörigkeit -
spiegelt die innere Zerrissenheit Israels:
zwischen religiöser Mythologie und moderner Staatlichkeit,
zwischen Shoah-Trauma und militärischer Selbstbehauptung,
zwischen innerer Angst und äußerem Machtanspruch.
Das, was man im Palästinenser zerstört,
ist das, was man selbst verloren hat:
die Fähigkeit, weich zu sein,
Vertrauen in das Leben,
Identität jenseits der Abgrenzung.
Das entschuldigt nichts.
Aber es erklärt, warum Gewalt als Ordnungsmittel erscheint:
weil innere Sicherheit fehlt.
Die Projektion des eigenen Schattens auf das Opfer
Eine der auffälligsten Dynamiken in missbräuchlichen Beziehungen ist die Projektion:
Der Täter überträgt eigene Anteile auf das Opfer, um sie dort zu bekämpfen.
Auch hier sehen wir genau das:
Alles, was Israel Palästina vorwirft - Aggression, Fanatismus, Unmenschlichkeit, Terror –, sind in Wahrheit die eigenen, unintegrierten Schattenanteile.
Dieses Prinzip schützt vor Selbstkonfrontation:
Wenn das Böse im Außen liegt, kann man sich selbst für „gut“ halten.
So entsteht ein geschlossener Kreislauf aus Selbsttäuschung, Schuldumkehr und moralischer Immunität -
ein System, das jede Form von Verantwortung abwehrt.
Und genau darin liegt das Gefährliche:
Denn solange der Täter nicht sieht, was er selbst tut,
wird das Opfer zum Spiegel, in dem er sein eigenes Gesicht nicht erkennen will.
Die Opfer-Dynamik: Palästina
So wie in häuslicher Gewalt ein Mensch ohne eigene Schuld zum Opfer wird,
so ist auch Palästina zum Opfer geworden -
nicht aus Schwäche,
sondern, weil es von Anfang an einem Machtgefüge ausgeliefert war,
das es nie gewählt hat.
Palästina hatte keinen Anteil an der Entstehung dieser Dynamik.
Es wurde hineingezogen, gezwungen, zu reagieren,
und erfuhr auf jede Gegenbewegung neue Gewalt.
Täter-Opfer-Umkehr
Wie in vielen Täter-Opfer-Systemen
wird die Verantwortung für das Geschehen oft umgekehrt -
das Opfer wird zur Mitverantwortlichen erklärt,
weil es sich wehrt.
Doch das ist eine erneute Verzerrung,
ein weiteres Kapitel der gleichen Gewaltgeschichte.
Wenn der Täter sich selbst im Opfer bekämpft
Palästina ist das, woran Israel sich reibt: das Leben selbst.
Der Teil, der weich bleibt, selbst in den Trümmern.
Der Weg in die Freiheit
Doch wie jedes Opfer, das lange kontrolliert wurde,
muss auch Palästina Wege finden, sich zu emanzipieren -
die eigene Stimme zurückzuerobern,
nicht nur durch Überleben, sondern durch Selbstdefinition.
Solange Palästina gezwungen wird, auf die Kontrolle des Anderen zu reagieren,
bleibt es Teil des Systems, das es unterdrückt.
Doch kein System existiert isoliert. Es braucht immer auch jene, die wegsehen oder stabilisieren - die Enabler.
Die Enabler - Der Westen
Und wie in jeder destruktiven Beziehung gibt es auch hier jene, die wegsehen.
Die sagen: „Es ist kompliziert.“
Die weiter Waffen liefern - und nicht einschreiten.
Enabler stabilisieren das System,
weil sie mehr Angst vor der Konfrontation haben
als vor der Wahrheit.
Was ein kollektiver Heilungsprozess braucht
Auf der individuellen Ebene wissen wir:
Täter-Opfer-Dynamiken sind nur schwer gemeinsam heilbar.
Heilung braucht Trennung, Distanz, Eigenverantwortung.
Der Täter muss konfrontiert werden und Verantwortung übernehmen -
nicht aus Strafe, sondern aus Bewusstwerdung.
Das Opfer muss befreit und geschützt werden -
um überhaupt wieder die Kraft zu finden, sich selbst zu spüren.
Erst nach dieser Phase individueller Aufarbeitung
kann etwas Kollektives entstehen - eine gemeinsame, neue Grundlage.
Und auch dann bleibt der Prozess fragil.
Südafrika hat nach der Apartheid gezeigt,
dass Aufarbeitung kein Ende hat -
aber dass Wahrheit, Zeugenschaft und Anerkennung
Voraussetzungen für Heilung sind.
Wenn wir also von kollektiver Heilung sprechen,
dann nicht von Versöhnung im romantischen Sinn,
sondern von einem langen Weg:
erst sehen, dann trennen, dann verstehen -
und vielleicht eines Tages, gemeinsam tragen.
Dieser Weg beinhaltet:
- Benennung der Gewalt (statt Verharmlosung)
- Entzug der Enabler-Dynamiken (politisch, wirtschaftlich, psychologisch)
- Wiederherstellung von Autonomie und Würde
- Traumaintegration statt Bestrafung
- Aufbau sicherer, neutraler Räume, in denen beide Seiten sprechen können -
nachdem Machtungleichgewichte benannt und korrigiert wurden.
Ohne das bleibt es ein Tanz um Macht, Gewalt und Abhängigkeit.
Deutschlands Rolle und Verantwortung
Der Historiker Omer Bartov sieht in Deutschland einen möglichen Partner im Prozess der Aufarbeitung - als Nation, die gelernt hat, Schuld zu benennen und Verantwortung zu übernehmen für seine Taten im Dritten Reich und insbesondere als Täter des Holocaust.
Ich teile diese Hoffnung, wenn auch mit Vorbehalt.
Denn Deutschland ist noch immer tief verstrickt - in seiner eigenen Scham, in der Angst, wieder Täter zu sein, und in der Loyalität zu einem Staat, der längst selbst zum Täter geworden ist.
Als Angela Merkel 2008 die Sicherheit Israels zur deutschen Staatsräson erklärte, war das ein Akt moralischer Selbstvergewisserung - geboren aus der Sehnsucht nach Stabilität, nicht aus Bewusstheit. Doch genau darin liegt das Problem: Was einst Sicherheit versprach, wirkt heute wie ein emotionaler Panzer, der echte Verantwortung verhindert.
Vielleicht liegt auch hier Heilung:
Wenn Deutschland beginnt, die eigene Geschichte nicht länger durch Schamabwehr, sondern durch Bewusstheit zu tragen, kann es aus der Enabler - Rolle heraustreten -
und zu dem werden, was es oft zu sein versucht: ein Raum für Menschlichkeit.
Der heilende Raum
Heilung hieße:
- beide Traumakörper sichtbar machen - den des Beherrschten und den des Kontrollierenden,
- das Tabu brechen, dass Täter keine Opfer und Opfer keine Täter sein dürfen,
- Räume schaffen, in denen beides gehalten werden darf - Schmerz und Verantwortung.
In der Praxis:
- kollektive Trauerarbeit - gemeinsames Betrauern beider Seiten,
- symbolische Wiederherstellung von Würde (z. B. Anerkennung der Nakba),
- bewusste Dekolonisierung des eigenen Selbstbilds (in Israel wie im Westen),
- Förderung echter Begegnungen - nicht über Politik, sondern über Menschlichkeit.
Die Anerkennung der Täterschaft
Ein wesentlicher Aspekt jedes Heilungsprozesses ist die Anerkennung der Täterschaft.
Ohne sie bleibt jede Aufarbeitung oberflächlich - ein Wechsel der Rhetorik, aber kein Wandel im Bewusstsein.
Doch wie bringt man einen Täter - oder in diesem Fall: ein ganzes Land – dazu,
sich dem eigenen Schatten zu stellen?
Wir wissen aus der Geschichte:
In Deutschland hat es Jahrzehnte gedauert, bis die Verantwortung für den Holocaust wirklich übernommen wurde.
Und selbst heute ist diese Integration noch nicht abgeschlossen.
Das zeigt: Kollektive Schuldabwehr ist zäh.
Auch Israel befindet sich in dieser Spannung:
geboren aus Verfolgung, getrieben vom Wunsch, geliebt zu werden –
und doch gefangen in der Angst, wieder gehasst zu werden.
Diese Ambivalenz schafft ein Bewusstsein,
das Verantwortung als Bedrohung erlebt, nicht als Erlösung.
Auf der individuellen Ebene kennen wir das gut:
Der Täter, der sich selbst nicht vergeben kann,
verweigert Verantwortung, um den Schmerz nicht zu fühlen.
Auf kollektiver Ebene braucht es daher Sichtbarkeit und Spiegelung von außen -
ein internationales Umfeld, das nicht länger stabilisiert, sondern konfrontiert.
Südafrika hat gezeigt:
Heilung beginnt erst dort, wo die Wahrheit ausgesprochen wird –
nicht, um zu verurteilen,
sondern um die Realität wieder bewohnbar zu machen.
Vielleicht ist das die Aufgabe der kommenden Jahre:
Israel nicht zu verdammen,
sondern so lange zu spiegeln,
bis es sich selbst erkennt.
Wie bringt man einen Täter zur Selbstwahrnehmung?
Auf individueller Ebene wissen wir: Anerkennung entsteht nicht durch Beschämung, sondern durch sichere Prozesse, in denen Wahrheit sichtbar, Verantwortung folgenreich und Reue möglich wird.
Auf kollektiver Ebene heißt das: Dokumentation, Zeugenschaft und Rechenschaft müssen Hand in Hand gehen mit politischen Kosten für Leugnung (Sanktionen, Isolation) und mit Räumen für innere Arbeit (Wahrheitskommissionen, öffentliche Spiegelung).
Praktisch bedeutet das: die systematische Veröffentlichung von Beweisen, die Unterstützung palästinensisch geführter Übergangspläne, juristische Schritte gegen Verantwortliche und die Stärkung interner Kritiker:innen in Israel.
Kurz: man muss so lange und so viel spiegeln - faktisch, moralisch und politisch - bis Leugnung nicht mehr tragbar ist.
Ich weiß nicht, wie ein Volk das erträgt -
den Moment, in dem es sich selbst erkennt,
nicht mehr als Opfer, sondern als Täter.
Vielleicht wird es dann still.
Vielleicht zerbricht etwas.
Auf dass daraus etwas Neues erwachsen kann.
Ich denke an jene Israelis, die jetzt bereits hinsehen.
Die wissen, was geschieht - und trotzdem in diesem Land leben.
Wie sie wohl atmen, inmitten dieser Schuld?
Wie sie schlafen, wenn das Gewissen nagt?
Vielleicht sind sie es, die schon jetzt den Schmerz fühlen,
den ihr Volk noch verdrängt.
Vielleicht sind sie die ersten,
die in Wahrheit schon begonnen haben zu heilen.
Heilung beginnt dort, wo Kontrolle endet
Solange Israel Kontrolle braucht, um zu existieren,
wird es sich selbst nicht finden.
Und solange Palästina in die Opferrolle gedrängt wird,
bleibt es abhängig.
Wer hilft Opfern üblicherweise, sich zu befreien und zu heilen?
Wer macht Täter verantwortlich?
Wer sorgt dafür, dass nicht länger Täterschutz, sondern Opferschutz betrieben wird?
Genau diese Fragen lassen sich auch kollektiv stellen -
für Palästina, für Israel,
für uns alle, die zusehen.
Ich lege diese Fragen ins Feld.
Denn noch gibt es keine wirklichen Antworten -
nur das Wissen,
dass Heilung beginnt,
wo Kontrolle endet.
 Was wir tun können - im Kleinen wie im Großen
Was wir tun können - im Kleinen wie im Großen
- Spiegle Wahrheit - nicht Meinung.
Verwende deine Stimme, um sichtbar zu machen, was ist - nicht, um zu überzeugen.
Zeige auf, ohne zu beschämen. Sprich über Strukturen, nicht über Feindbilder.
Bewusstsein wächst nicht durch Lärm, sondern durch Klarheit. - Halte das Gespräch offen - auch wenn es schmerzt.
Wer schweigt, stabilisiert Gewalt.
Wer schreit, schließt Türen.
Versuche, den Raum dazwischen zu halten - wo Menschen noch zuhören können, auch wenn sie anderer Meinung sind.
Das ist mühsam. Aber genau dort passiert Bewegung. - Unterstütze Zeugenschaft.
Teile Stimmen von Palästinenser:innen, israelischen Dissident:innen, Ärzt:innen, Journalist:innen.
Jede dokumentierte Erfahrung widerspricht dem Schweigen.
Zeugenschaft ist der Anfang jeder Wahrheit. - Ziehe Grenzen der Komplizenschaft.
Achte, wohin Du Dein Geld, Deine Aufmerksamkeit, Deine Zustimmung gibst.
Politischer Wandel beginnt oft mit der Entscheidung, was man nicht mehr unterstützt -
sei es durch Konsum, Kooperation oder Schweigen. - Halte Dein Herz offen.
Es ist leicht, zu versteinern vor Wut oder Ohnmacht.
Doch Bewusstsein ist nicht Härte, sondern Durchlässigkeit.
Halte Mitgefühl - auch dort, wo Du entsetzt bist.
Denn wahre Veränderung entsteht nicht aus Hass,
sondern aus der Weigerung, das Herz zu verschließen. - Und vielleicht ist das Wichtigste:
Auch wenn es unerträglich ist - wir dürfen nicht wegsehen.
Nicht bei häuslicher Gewalt.
Nicht bei sexualisierter Gewalt.
Und nicht, wenn sie kollektiv geschieht – in Gefängnissen, in Lagern, unter Besatzung.
Wegsehen ist der älteste Komplize der Gewalt.
Hinschauen ist der erste Schritt zur Heilung.
Nachwort - Warum ich hierüber schreibe
Ich schreibe dies nicht, um anzuklagen,
sondern um Muster sichtbar zu machen.
Bewusstsein ist kein politischer Akt.
Es ist ein heilender.
Und manchmal beginnt Heilung dort,
wo jemand den Mut hat, hinzusehen.
Über den Zionismus - und warum ich ihn hier nur am Rand erwähne
Der Zionismus ist ein zentraler Bestandteil dieser Geschichte - eine Ideologie, die aus Schutz geboren wurde und in Kontrolle mündete.
Er ist das ideologische Fundament, das die Täter-Opfer-Dynamik überhaupt erst ermöglicht hat: die Idee, Sicherheit könne nur durch Abgrenzung, Überlegenheit und Gewalt bestehen.
Ich lasse ihn in diesem Text bewusst nur am Rand stehen.
Denn mein Fokus liegt hier auf den psychologischen Dynamiken von Gewalt und Kontrolle - nicht auf der ideologischen Analyse.
Doch klar ist:
Wer über Heilung spricht, wird über kurz oder lang auch über den Zionismus sprechen müssen.
Über die Frage, ob ein ethnonationales Projekt überhaupt eine friedliche Zukunft haben kann.
Und darüber, was entstehen könnte, wenn dieses System losgelassen wird - zugunsten eines Landes, das allen gehört, die dort leben.
Es ist der einzig mögliche Schritt - so schwierig er erscheint:
Ein Land für alle.
"Vor den Briten waren wir einig - ein Land für alle heilig."
Juden, Christen und Muslime haben in Palästina über Jahrhunderte friedlich zusammen gelebt - es ist also möglich - es sollte wieder möglich sein.
Bildquelle:
Titelbild (Baum spiegelt sich in Wasser): Foto von Siebe Vanderhaeghen auf Unsplash